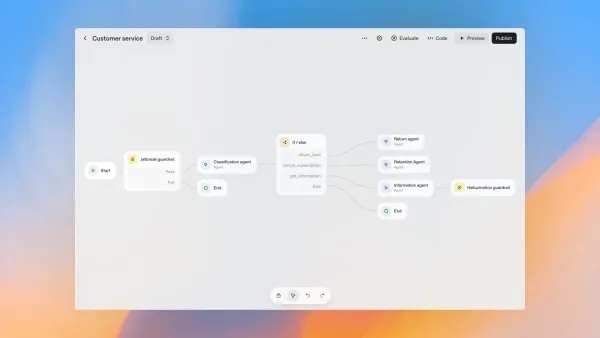Der 129. Deutsche Ärztetag hat sich intensiv mit der Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) in der medizinischen Versorgung beschäftigt. Die Delegierten unterstützen die Einführung lernender Systeme in Klinik und Praxis, fordern aber klare Rahmenbedingungen, um Patientensicherheit, Datenschutz und ärztliche Verantwortung zu gewährleisten. Die Debatte spiegelt die wachsende Bedeutung von KI-Technologien im Gesundheitswesen wider und betont die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Implementierung.
ZENTRALE Überblick
- KI-Systeme werden zunehmend Teil des medizinischen Alltags, insbesondere zur Effizienzsteigerung und Unterstützung bei Diagnose und Therapie
- Ärztetag fordert: KI-Einsatz nur bei geprüfter Sicherheit, Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht und starker Einbindung ärztlicher Perspektiven
- Europa soll unabhängig von internationalen Tech-Konzernen eigene KI-Lösungen für die Medizin entwickeln
Aktuelle Entwicklungen und Positionen
Lernende Systeme und KI-Anwendungen werden laut Experten schon in wenigen Jahren alltäglich in der Medizin sein. Sie übernehmen Aufgaben in der Verwaltung, unterstützen bei Diagnosen und Therapien und können teilweise sogar ärztliche Tätigkeiten ersetzen. Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), betonte, dass KI heute bereits medizinische Praxis ist, jedoch Fragen nach Datensicherheit, Transparenz und ärztlicher Verantwortung aufwirft.
Prof. Dr. Aldo Faisal, Digital-Health-Forscher und Mitglied im Deutschen Ethikrat, hob in seinem Grundsatzreferat hervor, dass das Gesundheitssystem durch KI profitieren kann. Studien zeigen, dass KI Risikopatienten identifizieren und Todesfälle verhindern kann. Sein Fazit: "Daten retten Leben." Dennoch befindet sich die Implementierung von KI in der Medizin laut Prof. Dr. Ulrike Attenberger, Leiterin der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin in Wien, noch in einem sehr frühen Stadium. Sie betonte, dass der Erfolg von KI-gestützten Diagnosen maßgeblich von der Qualifikation der Anwender abhängt, da erfahrene Ärzte Fehler in den KI-Vorschlägen besser erkennen und so die Systeme weiterentwickeln können.
Ärztliche Verantwortung und Patientenschutz
Der Ärztetag stellt klar, dass die Arzt-Patienten-Beziehung im Zuge der Digitalisierung nicht in den Hintergrund geraten darf. KI soll nur dann eingesetzt werden, wenn sie evaluiert und validiert ist, der Datenschutz gewahrt bleibt und die ärztliche Schweigepflicht geschützt wird. Die Delegierten fordern verbindliche Standards und eine kontinuierliche ärztliche Kontrolle bei der Anwendung von KI im Gesundheitswesen.
Priv.-Doz. Dr. Peter Bobbert, Co-Vorsitzender des Ausschusses "Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung" der BÄK, mahnte zur Eile. Angesichts des rasanten Tempos der KI-Entwicklung müssten berufspolitische Entscheidungen und die ärztliche Weiterbildung schnell angepasst werden. Er forderte, dass Europa bei der KI-Entwicklung Souveränität und Unabhängigkeit anstreben und nicht auf internationale Tech-Konzerne angewiesen sein dürfe. Ziel sei ein europäischer "Airbus-Moment" für die medizinische KI.
Strategische Grundlagen und Forderungen
Die Bundesärztekammer hat mit dem Thesenpapier "Künstliche Intelligenz in der Gesundheitsversorgung" und der Stellungnahme "Künstliche Intelligenz in der Medizin" zentrale Anforderungen für die digitale Zukunft formuliert. Diese Papiere bildeten die Grundlage der Beratungen auf dem Ärztetag. Sie fordern unter anderem eine strenge Prüfung und Validierung von KI-Anwendungen, die Sicherstellung des Datenschutzes und Schutz der ärztlichen Schweigepflicht, eine starke ärztliche Einbindung und Kontrolle bei der Nutzung von KI sowie die Förderung der ärztlichen Weiterbildung im Umgang mit digitalen Technologien.
Erik Bodendieck, Co-Vorsitzender des Digitalisierungsausschusses, hob hervor, wie differenziert und informiert die Ärzteschaft das Thema diskutiert. Die Vorarbeit für die KI-Zukunft sei geleistet, nun gehe es um die konkrete Umsetzung und Regulierung.